Anleihen: planbare, aber meist zu niedrige Erträge …
Für ein sicheres Zusatzeinkommen kommen in erster Linie Anleihen von soliden Schuldnern in Betracht. Denn die Zinszahlungen fließen nicht nur regelmäßig zu einem bestimmten Termin, sondern im Normalfall auch immer in der gleichen Höhe (bis zur Anleiherückzahlung). Mit etwas Geschick bei der Anleiheauswahl – oder entsprechenden ETFs/Fonds zwecks Risikostreuung – stellt man sicher, dass sich die Zinszahlungs- bzw. Ausschüttungstermine gleichmäßig übers Jahr verteilen. Manko hierbei: Anleihen solider Schuldner werfen aktuell keine allzu hohen Zinsen ab, an denen meist auch noch die Abgeltungsteuer (plus Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) nagt. Man benötigt deshalb schon ein vergleichsweise großes in Anleihen investiertes Vermögen, um ein nennenswertes Zusatzeinkommen in Form von regelmäßigen Zinszahlungen zu erzielen.
… und da kommen Dividenden ins Spiel
Einige Anlegerinnen und Anleger fokussieren sich deshalb auf Dividenden, also auf die Gewinnausschüttungen von Aktiengesellschaften an ihre Aktionärinnen und Aktionäre. Die Höhe der Dividende hängt vom Unternehmenserfolg ab und wird jedes Jahr neu auf der Hauptversammlung beschlossen. Es besteht jedoch kein Anspruch auf eine Dividende, selbst wenn Gewinne erzielt werden. Die Auszahlung erfolgt üblicherweise einmal jährlich (bei ausländischen Aktien teilweise auch halbjährlich oder quartalsweise) und Dividenden unterliegen ebenfalls der Abgeltungsteuer.
Was Dividenden auf den ersten Blick interessant macht: Es gibt etliche Aktiengesellschaften, deren Aktien eine Dividendenrendite ausweisen, die deutlich über der Verzinsung der bereits erwähnten soliden Anleihen liegt. Die Dividendenrendite ist eine Kennzahl (ausgedrückt in Prozent), die angibt, wie hoch die jährliche Dividendenausschüttung eines Unternehmens im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs ausfällt. Zahlt ein Unternehmen beispielsweise eine Dividende von 5 Euro und notiert die Aktie aktuell bei 100 Euro, errechnet sich daraus eine Dividendenrendite in Höhe von 5 %. Im Vergleich zu den ertragsschwächeren Anleihen ließe sich mit dividendenstarken Aktien somit der Wunsch nach einem Zusatzeinkommen scheinbar deutlich leichter realisieren.
Bei der Verfolgung einer Dividendenstrategie kann man auf einzelne Aktien oder Dividendenfonds bzw. -ETFs setzen. Bei Letzteren wird zumindest das Problem der mangelhaften Streuung deutlich entschärft – die mit Dividendenaktien grundsätzlich verbundenen Probleme jedoch bleiben.
Dividenden(aktien) vermitteln ein (falsches) Sicherheitsgefühl
Viele Anlegerinnen und Anleger glauben zudem, dass Aktien mit einer hohen Dividendenrendite eine Art Sicherheitspuffer bieten. Die Annahme dahinter: Wenn es an den Börsen einmal turbulent zugeht, sind dividendenstarke Aktien besonders widerstandsfähig, weil die hohe Dividende Kursverluste abfedert – und sie deshalb in Krisenphasen auch seltener abverkauft werden. Zudem werden dividendenstarke Unternehmen nicht selten als kerngesund angesehen. Beides in Kombination führt oft zu der (irrigen) Annahme, dass es sich bei Dividendenaktien um eine Art „Fels in der Brandung“ in stürmischer (Börsen-)See handelt. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: sicheres Zusatzeinkommen und obendrein gut gewappnet bei Börsenstürmen.
Lassen Sie uns zunächst die Krisenfestigkeit von dividendenstarken Aktien in der Vergangenheit anhand von harten Kennzahlen beleuchten.
Dividendenaktien enttäuschen öfter, als viele glauben
Wir haben die Wertentwicklung eines breiter gestreuten, auf „normale“ Standardwerte fokussierten Aktienindex (MSCI World1) mit einem Index verglichen, der auf vergleichsweise hohe Dividendenrenditen zugeschnitten ist (MSCI World High Dividend Yield) – und zwar über vier Zeiträume hinweg: 10, 15, 20 und 30 Jahre. In allen Zeiträumen hatten die „normalen“ Standardwerte hinsichtlich der Wertentwicklung (Dividenden plus Kursgewinne) die Nase vorn – teilweise sogar deutlich (siehe nachfolgende Grafik und Tabelle).
Hinzu kommt: Die bessere Wertentwicklung der Standardaktien wurde nicht etwa durch ein höheres Risiko erkauft. Die Volatilität, d. h. die durchschnittliche Schwankungsintensität (und damit das Risiko), war nicht erheblich höher als bei den dividendenstarken Aktien. Interessant ist zudem, dass die jeweils erlittenen Maximalverluste in zwei der gemessenen Zeiträume beim breiteren Standardwerte-Index spürbar geringer waren als bei den Dividendentiteln. Dass der Index mit Dividendenfokus bei beiden Risikokennziffern nicht wirklich überzeugen kann, ist besonders bemerkenswert, weil nach unseren Erfahrungen einige Anlegerinnen und Anleger sogar durchaus bereit wären, gewisse Renditeabschläge in Kauf zu nehmen, wenn die Dividendenstrategien sie dafür besser schlafen ließen.


Der Renditevorsprung der Standardwerte und der nur leichte Volatilitätsunterschied im Vergleich zu Dividendenaktien hat dazu geführt, dass in drei der vier untersuchten Perioden das Rendite-Risiko-Verhältnis (gemessen anhand der sog. „Sharpe Ratio2“) für den breiter gestreuten Index spricht.
Schlussfolgerung: Die weitverbreitete Annahme, dass Dividendenaktien in schwachen Börsenphasen besonders widerstandsfähig sind, lässt sich durch unsere Untersuchungen nicht belegen – das Gegenteil ist eher der Fall.3
Dass das vermeintlich sichere Zusatzeinkommen letztlich auf wackligen Beinen steht, hat verschiedene Gründe.
Knackpunkte der Dividendenstrategie
Hohe Dividendenrendite als Warnsignal: Wenn der Aktienkurs stark gefallen ist und die Dividende (vorerst) unverändert bleibt, steigt die Dividendenrendite (teils stark) an. Da die Dividendenrendite als Verhältnis der (unveränderten) Dividende zum aktuellen Aktienkurs berechnet wird, führt ein stärkerer Kursrückgang also automatisch zu einer teils deutlich höheren Rendite. Ein Kurssturz deutet aber naturgemäß oft auf wirtschaftliche oder schwerwiegende unternehmensspezifische Probleme hin, die zu sinkenden Gewinnen und eventuell auch zu kräftigen Dividendenkürzungen bis hin zum Ausfall führen können.
(Hohe) Dividenden sind nicht garantiert: Unternehmen können ihre Dividenden jederzeit kürzen oder streichen, besonders in Krisenzeiten. Eine beim Aktienkauf zunächst verlässlich erscheinende Dividendenkontinuität kann sich somit schnell in Luft auflösen.
Risiko „Substanzverzehr“: In extremen Fällen finanzieren Unternehmen die Dividende sogar aus Krediten oder aus der Unternehmenssubstanz, um die Tradition der kontinuierlichen Ausschüttung aufrechtzuerhalten. Dieses Vorgehen schmälert am Ende den Unternehmenswert. Manchmal werden hohe Dividenden auch ganz gezielt dafür eingesetzt, um von firmeninternen Problemen abzulenken und um Investorinnen und Investoren zu beruhigen.
(Zu) hohe Dividendenzahlungen können aber auch aus weniger dramatischen Gründen ein Problem für ein Unternehmen und für die langfristige Aktienkursentwicklung werden. Denn schüttet ein Unternehmen zu viel Dividende mit Blick auf seinen erwirtschafteten Gewinn aus, fehlt womöglich Geld für wichtige Zukunftsinvestitionen oder Umstrukturierungen. Was hilft eine attraktive Dividende, wenn das Unternehmen als Folge mangelnder Liquidität bei Innovationen von der Konkurrenz abgehängt wird? Das führt zu einem weiteren Knackpunkt:
Wachstumsstarke Firmen bleiben oft außen vor: Viele erfolgreiche Wachstumsunternehmen (speziell aus den USA) schütten keine oder nur geringe Dividenden aus, da sie die erwirtschafteten Gewinne lieber ins eigene Wachstum reinvestieren. Anlegerinnen und Anleger, die sich ausschließlich auf die Dividendenstrategie fokussieren, schließen solche Unternehmen von vornherein aus und verpassen die damit verbundenen Kurschancen.
Unzureichende Diversifikation: Da bei der Dividendenstrategie die Auswahl auf etablierte, regelmäßig hoch ausschüttende Unternehmen begrenzt ist, wird die Bandbreite der im Portfolio enthaltenen Titel deutlich verringert, was letzten Endes auch das Risiko spürbar erhöht.
Ballung der Dividendenzahlungen: Eine Strategie aufzubauen, bei der regelmäßig über das ganze Jahr verteilt Dividendenzahlungen erfolgen, dürfte hochkomplex sein. Die Dividendensaison in Deutschland beispielsweise beginnt typischerweise im Frühjahr. Die meisten Unternehmen zahlen im Zeitraum von April bis Juni die Dividende an ihre Aktionärinnen und Aktionäre aus. Danach sind die Dividendentermine eher rar gesät.
Und wenn man trotz allem die „Dividendenkönige“ dem Depot beimischen möchte?
Vernünftig gestreute Aktienportfolios haben dividendenstarke Aktien mit im Gepäck
Diese Frage stellt sich bei einer sauberen Zusammenstellung des Depots gar nicht. Hintergrund: In einem weltweit möglichst breit gestreuten Portfolio sind auch dividendenstarke Aktien automatisch mit vertreten – so auch in unserer Vermögensverwaltung4. Und wer – speziell im Ruhestand – eine weitere regelmäßige Einnahmequelle wünscht, kann sich für einen Auszahlplan entscheiden, der sich aus unseren Vermögensverwaltungsstrategien speist.
Die Historie zeigt zudem: Wenn man einem global breit gestreuten Aktiendepot genug Zeit lässt, um sich zu entwickeln, kann man später mit passgenauen Auszahlplänen Entnahmen darstellen, ohne dass die Substanz des Portfolios angegriffen wird – und ohne dabei allzu sehr auf Dividendenzahlungen fokussiert zu sein.
Viele Anlegerinnen und Anleger haben nämlich die Vorstellung, dass sie, wenn sie nur die Dividenden entnehmen, die Substanz erhalten. Das ist aber genau gesehen ein Trugschluss. Denn wie sich die Substanz entwickelt, hängt schließlich von der Kursentwicklung ab. Wenn also die Kurse fallen, dann reduziert sich die Substanz, auch wenn nur die Dividenden entnommen werden. Umgekehrt heißt das, dass die Substanz nicht zwingend reduziert wird, wenn Teile des Portfolios verkauft werden, um Zusatzeinkommen zu generieren – nämlich dann, wenn die Kurse steigen, was Aktienkurse letztlich langfristig auch tun.
Es ist also nicht unbedingt nötig, nur auf die Dividenden zuzugreifen. Um ein bestimmtes Einkommen zu erhalten, kann man in einem gewissen Umfang durchaus auch Aktien verkaufen, ohne dass deshalb die Substanz ernsthaft leidet. Wie viel konkret möglich ist, lässt sich im Einzelfall sogar relativ zuverlässig berechnen.

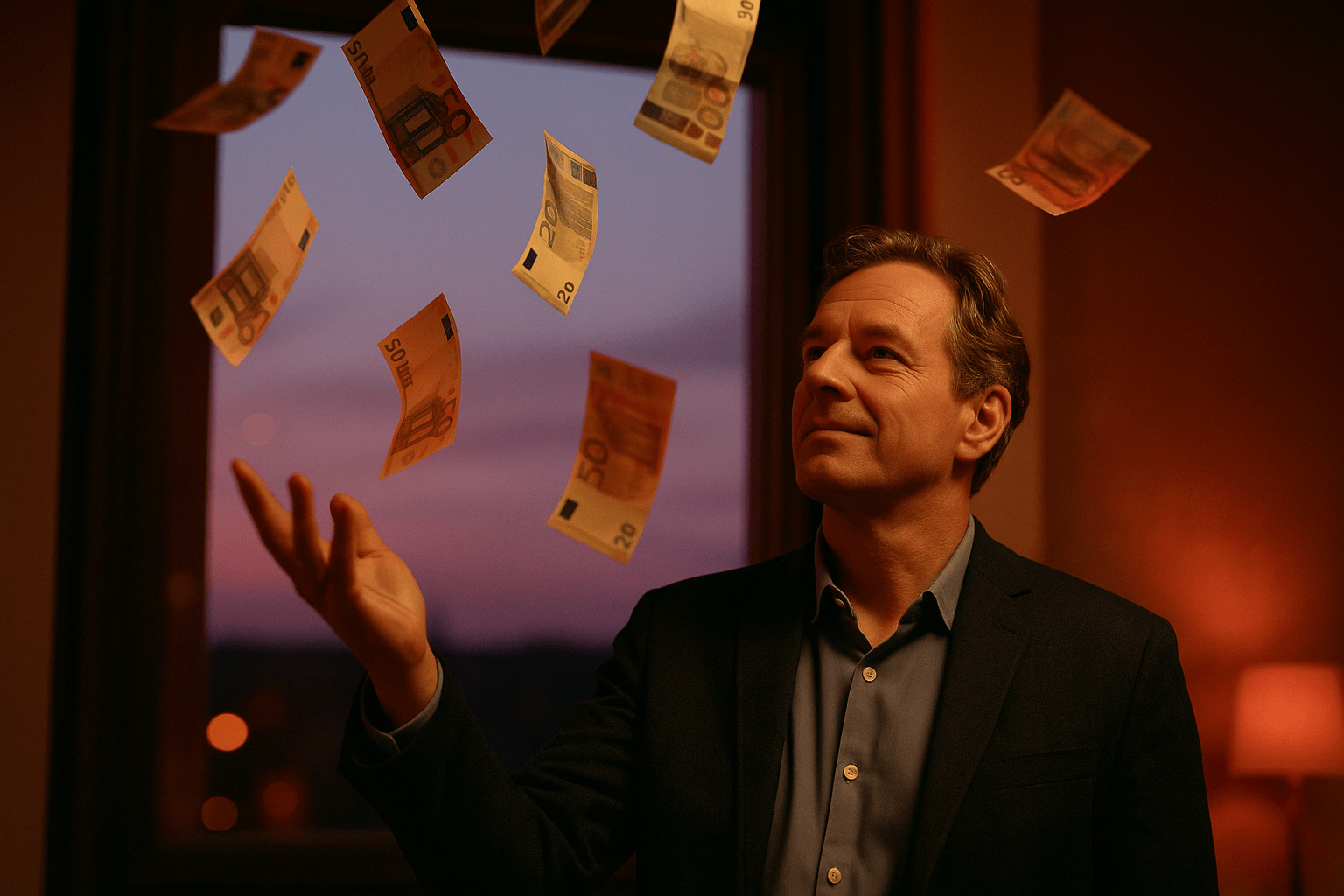









.webp)